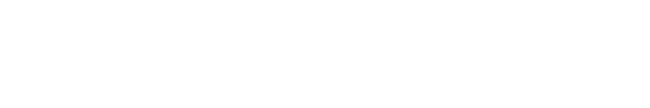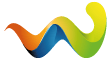Ich schwor, es ihnen heimzuzahlen
Ralf Weber verbrachte zwölf Jahre in Heimen der DDR / Forscher sprechen vom „geschlossenen System“
POTSDAM - Fünzig Jahre hat es gedauert, bis das Regime in Kinderheimen der jungen Bundesrepublik am „Runden Tisch Heimerziehung“ offengelegt wurde. Ein Ergebnis des Abschlussberichts von 2011: Ein Fonds zur Entschädigung ehemaliger Heimkinder. Am 26. März will nun auch die Arbeitsgruppe „Aufarbeitung DDR-Heimerziehung“ des Bundes und der Länder einen Abschlussbericht vorlegen. Auch hier wird es darum gehen, wie den Opfern eines unmenschlichen Systems geholfen werden könnte.
Da ist zum Beispiel Ralf Weber. In einer Tagung an der Fachhochschule Potsdam (FHP) über die Heimerziehung in beiden Teilen Deutschlands hat der 56-Jährige schon eine Stunde lang wie ein Wasserfall über sein Leben in Heimen der DDR erzählt. Dann schnauft und schluckt er. Weber erinnert sich an die Selbstmorde seiner Leidensgenossen im damaligen Jugendwerkhof Torgau im Norwesten Sachsens.
„Ein Junge hat sein Turnhemd in Streifen gerissen und sich erhängt“, sagt Weber mit belegter Stimme. „Wir hatten Jugendliche, die sich körperlich verletzten, nur um hier heraus zu kommen.“ Manche hätten Eisenspäne verschluckt, manche Säure getrunken. Weber tat etwas anderes. „Nach einer Woche bin ich zum Entschluss gelangt, dass ich das hier überleben würde“, sagt er. Als ihn am zweiten Tag zwei Erzieher zusammenschlugen, schwor er sich, ihnen das irgendwann heimzuzahlen.
Weber war wegen eines Fluchtversuchs aus dem südlich von Jena gelegenen thüringischen Jugendwerkhof Hummelshain – dem einzigen, den er je unternommen hatte – nach Torgau gebracht worden. Am Morgen nach seiner Ankunft nahm sich der Direktor acht Stunden lang des Neuen an. Mit halboffenen Turnschuhen musste Weber im Hof auf Schotter laufen. Die Splitter gerieten in den Schuh und schnitten in Webers Fuß. Der Fünfzehnjährige musste Liegestütze machen, bis ihm auch die Hände zerschnitten waren. Als er sich vor Verzweiflung gegen eine Mauer warf, um ohnmächtig zu werden, hieb ihm der Leiter der Einrichtung so lange mit dem Schlüsselbund ins Gesicht, bis Weber sich weiter mit Liegestützen abquälte.
Torgau. Der Name des Jugendwerkhofs weckte in Heimkindern der DDR grausige Vorstellungen. Vom 1. Mai 1964 bis zum 11. November 1989 wurden mehr als 4000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren zur angeblichen „Anbahnung eines Umerziehungsprozesses“ eingewiesen. Doch um Umerziehung ging es im einzigen offiziell geschlossenen Jugendwerkhof der DDR nicht. Tatsächlich sollte der Wille der Insassen gebrochen und denjenigen gedroht werden, die noch nicht drinnen gewesen waren. Heute ist der Ort eine von der Europäischen Union ausgezeichnete Gedenkstätte.
Manfred Kappeler, ermeritierter Sozialpädagoge von der Technischen Universität (TU) Berlin, nennt Torgau ein Symbol für die Heimerziehung der DDR überhaupt. „Die ganze Heimerziehung der DDR war ein geschlossenes System“, sagt er. Die Türen blieben in allen Heimen zu, die Kinder waren in einem Gefängnis. Torgau sei nur der Endpunkt einer Reihe von Maßregelungen gewesen.
Kappeler hat in den 70er Jahren in einer Art Undercover-Recherche die Missstände in den westdeutschen Heimen aufgedeckt. Vor zwei Jahren hat er in einer Studie über Berliner Heimerziehung auch die Heime in Ost-Berlin betrachtet. Während der Westen vor allem schwierige Kinder aus dem Arbeitermilieu an die Kandarre nahm, sollten in der DDR „Nicht-Kollektivfähige“ zu sozialistischen Persönlichkeiten werden. Dafür gab es Handreichungen zum Beispiel vom Institut für Jugendhilfe in Falkensee. Eberhard Mannschatz, bis 1977 Funktionär im DDR-Ministerium für Volksbildung, erläutert 1959 in einem Aufsatz die „Rolle der Ideologie bei der sozialistischen Umgestaltung der Jugendhilfe“. In Mannschatz’ Zuständigkeit fiel auch der Werkhof Torgau.
„Die Repressionen stiegen von Einrichtung zu Einrichtung“, sagt Weber. Angefangen hatte seine Leidensgeschichte Anfang der 60er Jahre. Die überforderte Mutter hatte jahrelang einen Scheidungskrieg gegen einen gewalttätigen, trinkenden Vater geführt. Als ein Gericht 1959 endlich ein Scheidungsurteil vollstreckte, war Ralf Weber vier Jahre alt.
Die geschiedene Mutter arbeitet ganztägig. Den schulpflichtigen Sohn weckt sie morgens um vier Uhr. Er steht ab sechs Uhr vor der Schule und wartet, bis sie geöffnet wird. Der Sechsjährige ist müde und unaufmerksam. Lehrer meinen, der Junge sei seinen Schulpflichten nicht gewachsen. Das ist der Moment, in dem die Jugendhilfe der DDR eingeschaltet wird. Die diagnostiziert bei dem unter Stimmungsschwankungen leidenden Kind eine latente Schizophrenie und einen angeblichen hirngenetischen Defekt. Mit dieser Diagnose ist das Schicksal des gebürtigen Thüringers besiegelt. In den folgenden Jahren durchwandert er vier verschiedene Erziehungsheime in der Republik.
In den Heimen ist das Reden im Schlafsaal verboten. Zu den Bestrafungen gehört zum Beispiel, stundenlang nackt im kalten Flur zu stehen. Im Berliner „Kombinat der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie“ wird der elfjährige Weber ab 1966 medizinisch behandelt. Weber spricht gar von illegalen Experimenten. Spritzen in die Hüften verursachen Magenbrennen und Krämpfe. Der Junge wehrt sich. Er wird auf dem Bett fixiert. Schwestern halten ihn fest, wenn ihm die Spritzen verpasst werden.
Webers Mutter und ihr neuer Mann fragen einen unabhängigen Mediziner. Der kennt die Medikamente nicht, die Ralf Weber bekommt. Ein Pulver, das ihm der Professor zur Linderung seiner Schmerzen gibt, wird dem Jungen in dem Heim wieder abgenommen.
Die Traumen, die Weber in diesen Jahren zugefügt wurden, haben ihre Spuren hinterlassen. Weber ist arbeitsunfähig und frühverrentet. Weiße Kittel versetzen ihn in Panik. Spritzen sind ganz unmöglich. Groll gegen seine Mutter hegt er aber nicht. Sie habe, soweit es ihre knapp bemessene Zeit zuließ, versucht, den Kontakt zu halten. Doch jedesmal, wenn sie und der Stiefvater in die Heimerziehung eingriffen, musste es Ralf Weber büßen – meistens mit Schlägen. Er selbst bat seine Eltern in Briefen, nichts mehr zu unternehmen.
Der Diplomsozialpädagoge der Fachhochschule Potsdam, Matthias Schreckenbach, der sich mit seinen Studenten lange mit der Heimerziehung in der DDR befasst hat, meint, Webers Deutung seiner medizinischen Behandlung sei unter Vorbehalt zu sehen. „Der Bericht ist aber sicher repräsentativ für die Erfahrungen im Jugendwerkhof Torgau.“ Was die Gewalt in den normalen Heimen angehe, machten andere Zeitzeugen ganz ähnliche Aussagen wie Weber. Dass er kein Einzelfall sei, habe auch das Land Brandenburg eingesehen. Der Diktaturbeauftragten des Landes, Ulrike Poppe, ist eine Abteilung zur Heimerziehung zugeordnet worden.
„Wir sind eine Stelle, die ein relativ großes Vertrauen genießt“, sagt die für Heimerziehung zuständige Beraterin Silvana Hilliger. Die Abteilung behandele keineswegs eine Marginalie der DDR. „Ich würde sagen, wir bekommen um die zehn Anrufe in der Woche“, sagt Hilliger. „Es sind oft lange Gespräche.“ Von schlimmen Erfahrungen berichten insbesondere ehemalige Insassen der sogenannten Durchgangsheime. „Dort ist die Situation besonders schlimm gewesen.“
Auch Heimforscher Kappeler sieht Webers Bericht durch die Befunde der DDR-Forschung gestützt. Sicher: „Es gab in beiden deutschen Staaten Erzieherinnen und Erzieher, die versucht haben, eine andere Praxis zu gestalten.“ Das ändere aber nichts am Zweck der Heime. Und der lautete: Disziplinierung.
Weber haben die Heime nicht diszipliniert. Sie haben im Gegenteil seine Wut angefacht. Seit der Wende kämpft Weber als Vorsitzender des Opferbeirates der Gedenkstätte Torgau dafür, dass die DDR-Heimerziehung als Verletzung elementarer Menschenrechte anerkannt wird. Ehemalige Heimkinder sollen entschädigt werden. Für seine Tage in Torgau hat ihm das Berliner Kammergericht schon 2004 Recht gegeben. Doch bei seiner Zeit als Insasse der „normalen“ Heime mauern die untergeordneten Gerichte. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht bereits 2009 sein Leben dort als widerrechtlichen Freiheitsentzug gewertet hat. (Von Rüdiger Braun)
Quelle : Märkische Allgemeine