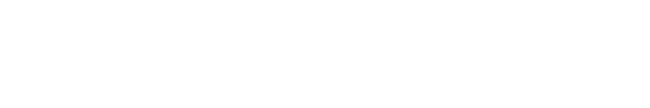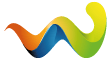Bis zu 16.000 Euro
Berlin entschädigt misshandelte Heimkinder
Mittwoch, 28. Dezember 2011 11:20 - Von Christine Kensche
Der Berliner Senat will ab Mitte Januar 2012 eine Beratungsstelle für misshandelte Heimkinder einrichten. Sie soll Anträge auf Entschädigung prüfen. Den Opfern stehen bis zu 16.000 Euro zu.
In West-Berlin und Westdeutschland gab es zwischen 1945 und 1975 insgesamt 800.000 Heimkinder. In der DDR waren es 120.000
Sie wurden geprügelt, gedemütigt und missbraucht. Nun können ehemalige Heimkinder auf eine baldige Entschädigung hoffen. Der Berliner Senat will ab Mitte Januar 2012 eine Beratungsstelle für misshandelte Heimkinder einrichten, die Anträge auf finanzielle Leistungen prüfen soll. Diese Maßnahme ist Teil des bundesweiten „Fonds Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949–1975“, der von dem Runden Tisch Heimerziehung empfohlen wurde und jetzt in die Praxis umgesetzt werden soll.
120 Millionen Euro umfasst der Fonds insgesamt, der zu je einem Drittel vom Bund, den Kirchen und den betroffenen Ländern gemeinsam mit den Kommunen finanziert wird. Berlin beteiligt sich mit 1,1Millionen Euro. Vorerst ist lediglich eine Entschädigung von Opfern aus den alten Bundesländern und West-Berlin vorgesehen. Der damalige Bildungssenator Jürgen Zöllner (SPD) hatte aber bereits im Sommer 2011 angekündigt, auch ostdeutsche Opfer finanziell zu entschädigen. Eine Arbeitsgruppe des Bundes und der östlichen Bundesländer will dazu bis Ende März Ergebnisse präsentieren.
Insgesamt 100 Millionen Euro sollen an westdeutsche Opfer fließen, die Folgeschäden aus der Heimerziehung, wie etwa Traumatisierungen oder „besonderen Hilfebedarf“ nachweisen können, heißt es in einer Vorlage des Senats an das Abgeordnetenhaus. 20 Millionen Euro stehen für Rentenersatzzahlungen zur Verfügung. Viele Heimkinder wurden ab ihrem 14. Lebensjahr zu Arbeiten verpflichtet. Bei einem Teil der Kinder führten die Heimleitungen jedoch die Beiträge zur Sozialversicherung nicht ab, woraus den Betroffenen später Nachteile bei der Rentenberechnung entstanden. Diese sollen durch die Ersatzzahlungen ausgeglichen werden. Vorwiegend aber soll Hilfe in Form von Sachleistungen wie der Finanzierung von Therapiemaßnahmen oder ambulanten Pflegekräften gewährt werden. Pro Antragsteller sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung bis zu 10.000 Euro an Hilfen vorgesehen; im Falle einer nicht angerechneten Arbeit im Heim noch einmal 6000 Euro zusätzlich an ausgleichenden Rentenzahlungen.
Die Studie „Heimerziehung in Berlin – West 1954–1975, Ost 1945-1989 schildert drastische Zustände in Berlins Heimen. Experten schätzen, dass es in West-Berlin in dem Zeitraum bis zu 30.000 Heimkinder gegeben hat. In Westdeutschland und West-Berlin gab es zwischen 1945 und 1975 800.000 Heimkinder, 120.000 in der DDR bis 1989. Der Bericht benennt etliche Einrichtungen, in denen Kinder misshandelt wurden – darunter das Kinderheim Königsheide, das Paul-Wenzel-Heim in Wannsee oder das Haus Conradshöhe in Tegel. Demnach litten die Kinder unter Schlägen, Isolation und sexuellen Übergriffen.
„Berlin hat mit der Dokumentation die Aufarbeitung vorangetrieben und dem Leid der Heimkinder eine Stimme verliehen“, sagte Sigrid Klebba, Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Bildung, Morgenpost Online. Dieses Unrecht könne zwar nicht ungeschehen gemacht werden, „aber wir können und müssen den Weg der Wiedergutmachung gehen“. Betroffene können ab Mitte Januar 2012 bis Ende 2014 Anträge auf Entschädigung einreichen. Berlin hat die gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit mit der Prüfung beauftragt. Der Verein Ehemaliger Heimkinder setzt jedoch wenig Vertrauen in die neu geschaffene Beratungsstelle: „Die Hürden sind so hoch angesetzt, dass wohl kaum jemand eine Entschädigung bekommen wird“, sagte der Vereinsvorsitzende Dirk Friedrich.
„Wir setzen auf schnelle und unbürokratische Hilfe“, sagt Thorsten Metter, Pressesprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Bildung. Für die Entschädigung muss der Hilfesuchende belegen können, dass er unter Folgeschäden durch die Heimerziehung leidet. „Das ist oft nicht einfach, da diese Zeit lange zurückliegt“, räumt Metter ein. „Aber die Nachweispflicht wird großzügig gehandhabt.“ Opfervertreter sehen diese Ankündigung skeptisch. Dirk Friedrich vom Verein Ehemaliger Heimkinder, der bundesweit rund 500, in Berlin etwa 30 Mitglieder hat, kritisiert: „Die Hälfte der Betroffenen verfügt maximal über eine Fotokopie ihrer letzten Heimakte. Wie sollen sie eine angemessene Entschädigung bekommen?“ Auch dass die Hilfen in Form von Sachleistungen gewährt werden sollen, lehnt er ab. „Wir fordern eine allgemeine monatliche Opferrente von 300 Euro“, so Friedrich.
Das Recht auf Entschädigung geht auf eine Initiative ehemaliger Heimkinder zurück, die sich 2006 an den Petitionsausschuss des Bundestages gewandt hatten. Der Runde Tisch Heimerziehung erarbeitete daraufhin eine Entschädigungslösung, welche der Bundestag im Juli 2011 auf den Weg brachte.
Quelle: Berliner Morgenpost