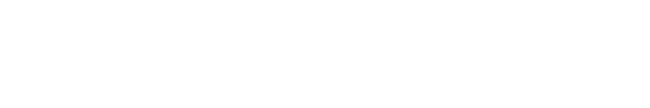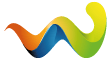.
Willi Hammer
„Der Steinbruch war die Hölle!“
Die Leiden eines jungen Mannes in einem Erziehungsheim in den sechziger Jahren
Voccawind, 28. Januar 1965 - „Guten Morgen. Aufstehen, alle Fenster auf, hier stinkt's!“ So oder ähnlich wurde an jenem Tag in aller Herrgottsfrühe in den Schlafsaal des Erziehungsheims auf dem Zeilberg beim Voccawind gebrüllt. Ich hatte in dieser Nacht nur wenig geschlafen, denn es war meine erste Nacht in dem großen Schlafsaal. Die Geräusche der anderen Zöglinge um mich herum ließen mich lange nicht einschlafen und sorgten auch für mein baldiges Erwachen, lange vor dem „Weckruf“ des Erziehers.
Obwohl ich schon länger wach auf dem eisernen Bett lag, mit einer alten, braunen Wolldecke zugedeckt, wurde mir erst durch das diffuse Licht der Glühbirnen an der Saaldecke, die mittlerweile den Raum in seiner ganzen Trostlosigkeit erkennen ließen, nach und nach meine Situation deutlich. Es war also kein Traum, der mir das alles vorgaukelte. Es war echt. Und auch die zweite Ansage des Erziehers, seiner Aufforderung Folge zu leisten, ließ den Rest meiner Zweifel schwinden.
Schnell sprang ich aus dem Bett. Ich weiß noch, dass ich mich strecken musste, um das Fenster neben meiner Schlafstätte zu erreichen, da ich nur 167 cm groß war und die Fenster allesamt weit oben angebracht waren. Die schneidend kalte Luft, die schon bald spürbar in den großen Schlafsaal strömte, ließ auch mich frösteln. Ich war Kälte gewohnt. Daheim in „meinem“ Bett, das ich „nur“ mit Opa teilen musste (meine drei Schwestern schliefen zu dritt in einem Bett), war es zwar auch so kalt, dass die Außenmauern der Schlafkammer im Winter des Öfteren mit einer Eisschicht bedeckt waren, aber in diesem riesigen Raum hier auf dem Zeilberg herrschte nun eine Eiseskälte, als stehe man an diesem Januarmorgen des Jahres 1965 im Freien.
[ SEITE 2: ]
Die verschlissene „Heim-Kleidung“, die ich nach meiner Ankunft am Vortag im Austausch für meine abgenommene Kleidung erhielt, hing ja noch an einem Haken nahe des Waschraums. Diese vermochte mich, wie ich bald erfahren durfte, nicht zu wärmen. So war ich froh, endlich vom Erzieher mitsamt den anderen ca. 70 Zöglingen, alle nur mit Unterhosen bekleidet, in den Waschraum geführt zu werden.
In der Vorfreude, mich gleich mit warmem Wasser waschen zu dürfen, betrat ich den länglichen Waschraum, um gleich darauf auch schon am anderen Ende desselbigen auf dem Boden vor der gefliesten Wand gegenüber des Eingangs zum Liegen zu kommen. Eine gewaltige Ohrfeige und ein oder zwei wuchtige Schläge auf meine Brust hatten mich durch den gesamten Waschraum „schlittern“ lassen. Zugeschlagen hatte der damals „Heimstärkste“, der Kaufmann Charlie. Er wollte damit sicherstellen, dass ich nicht wieder, wie am Vorabend unbewusst, als erster aufstand, als das Fernsehgerät vom Erzieher ausgeschaltet und wir zum Zubettgehen aufgefordert wurden. Dieses und andere „Vorrechte“ verteidigte der sog. „Heimstärkste“ gegenüber jedem Zögling. Ich wollte am Abend vorher keinesfalls Kaufmann Charlie provozieren, ich wollte nur ins Bett, um den ganzen Albtraum im Schlafe zu vergessen. So den Anblick des verletzten Zöglings, der bei meiner Ankunft im Erziehungsheim Voccawind blutüberströmt wimmernd in einer Mauernische neben der Eingangstüre lag. Der junge Kerl war im Steinbruch von einem herabfallenden Stein verletzt worden. Der Arzt sei schon informiert, ließen die um den Verletzten herumstehenden Zöglinge Heimleiter Plietsch sen. wissen, als dieser mit mir am Vortag hier ankam, nachdem er mich in Bamberg abgeholt hatte.
Der Beginn des Leidensweges
Zwei junge Männer hatten mich am 27. Januar 1965 aus der Wohnung meiner Mutter in München-Laim geholt, als ich mich anschickte, zur Arbeit zu gehen. Ich lernte damals Versicherungskaufmann. Sie sagten, ich hätte nun in der Landwirtschaft zu arbeiten, bis meine „Sache“ geklärt sei. Von Plietsch wurde mir auf der Fahrt von Bamberg nach Voccawind mitgeteilt, dass ich in einem Steinbruch zu arbeiten hätte, was mir ebenso unverständlich wie Arbeiten in der Landwirtschaft war. Für mich war unverständlich, dass so ein schmächtiger Kerl wie ich es war, bestenfalls in einem Steinbruchbüro, falls es ein solches gäbe, etwas zu suchen hätte.
Das mit dem Verstand ist so eine Sache. Ich hatte ja anscheinend schon damals davon mehr, als die Verantwortlichen in Voccawind. Ich wusste damals schon, dass Bettnässer – ich war bis etwa zur zweiten Klasse in der Volksschule selbst einer – nicht dadurch von ihrer meist psychischen Störung befreit wurden, indem man sie, wie in Voccawind geschehen, zum Schlafen in enge, geflieste Zellen sperrte, damit sie nicht die normalen Betten benässten, um sie dann, wenn sie darin uriniert hatten, mit einem starken, kalten Wasserstrahl aus dem „Käfig“ zu spritzen. Ja, und weil es für manche Erzieher so lustig war, durfte jeder der zufällig vorbeikommenden Zöglinge ihr Werk begaffen.
[ SEITE 3: ]
Ich verstand ja auch, dass es nicht zeitgemäß war, seinen Durst aus den Spülkästen der Toiletten zu stillen, da an heißen Tagen immer der in Aluminiumblechkannen gefüllte Tee schnell zur Neige ging. Die „Fleischbeilage“ im selbigen ( Mücken, Fliegen, Käfer) hingegen, die oft massenhaft auch den Tee genossen, schwammen bei Zeiten obenauf. Da war ja das Toilettenwasser noch ansprechender.
Doch mit Verstand wurde in Voccawind falsch umgegangen. Dort war man noch 1965 der festen Überzeugung, dass man die jungen Leute nur zur Arbeit zwingen müsse, und sei es im Steinbruch, dann würde schon was aus ihnen werden. Ja, und da wurde dann was aus uns. Da wurden wir dann geformt – nachhaltig geformt! Mein Orthopäde hat es mir bestätigt und meine schweren Bandscheibenvorfälle erinnern mich noch heute nachhaltig und vor allem schmerzhaft an meine „Formgeber“. Deren Verstand sagte ihnen damals anscheinend nicht, dass jugendliche Körper niemals mit solch harten Arbeitsprozessen in Berührung kommen dürfen. Und die Erzieher, besser die Erzwinger, konnten sich anscheinend auch nicht vorstellen, dass körperliche Überbelastungen bei so jungen Menschen sich später in Folgeschäden umwandeln würden.
Die Schläge im Waschraum des Erziehungsheims der Inneren Mission hinterließen keine Folgeschäden. Sie waren jedoch erst der Anfang einer Quälerei unvorstellbaren Ausmaßes für mich. Ich hatte vorher noch nie ernsthaft gerauft. Und außer einer blutenden Nase hatte ich bis dahin noch keine schlimmeren Verletzungen gesehen, es sei denn bei Verkehrsunfällen. Doch da konnte man wegschauen. In Voccawind ging das jedoch nicht. Da war man mittendrin. Da musste man „Farbe bekennen“, da konnte man nur für den einen oder den anderen sein. Da waren blutige Nasen nebensächlich. Gebrochene Rippen, ausgeschlagene Zähne und all die anderen Blessuren, die durch brutalste Schläge hervorgerufen werden, waren dort fast alltäglich.
Immer und immer wieder maßen die vermeintlich Starken ihre Kräfte. Und diese Zöglinge hatten keinerlei Hemmungen, ihren Kontrahenten Schmerzen zuzufügen. Und niemals vorher hätte ich es für möglich gehalten, dass sich Menschen so etwas gegenseitig antun würden. Und niemals vorher hätte ich es für möglich gehalten, dass ich solche Machenschaften akzeptieren würde. Ja, ich habe nach einiger Zeit das „Faustrecht“ anerkannt. Ja, ich habe mich dessen sogar bedient. Ich habe den Kaufmann Charlie als „Rauchpartner“ angeheuert.
„Rauchpartner“ wurden die Zöglinge genannt, mit denen man Übereinkommen zum gegenseitigen Nutzen abschloss. Der Stärkere der Partner verdingte sich vom anderen, mehr oder weniger von dessen monatlichen „Einkauf“, indem er ihm bei Übergriffen anderer Zöglinge half oder indem er ihm bei der schweren Arbeit im Steinbruch zur Hand ging, damit auch dieser die geforderte Menge von Loren mit den schweren Basaltsteinen beladen konnten. In der Regel bestand die „Bezahlung“ aus Zigaretten oder Süßigkeiten, die man im Heim, einmal monatlich, in kleinen Mengen erwerben konnte.
[ SEITE 4: ]
Ich entlohnte Kaufmann Charlie mit einer Schachtel Zigaretten. Das war für mich keine besondere Entbehrung, da ich Nichtraucher war. Dass mir aber deswegen das Geld für Süßigkeiten, welche ich gerne gehabt hätte, fehlte, war mein trauriges Los. Doch was sollte ich tun? Ich war ein kleiner, schmächtiger Junge, gerade mal 17 Jahre und 2 Tage alt, als ich aus meinem bisherigen Leben gerissen wurde. Und nun sollte ich schwere Basaltsteine in eine hohe Lore stemmen, die meist schwerer als ich selbst waren. Ich konnte anfangs die meisten Steinbrocken nicht einmal bewegen, geschweige denn hochheben. Also brauchte ich jemanden, der mir dabei zur Hand ging. Und Kaufmann Charlie ging mir zur Hand. Mit ihm schaffte ich es, die erforderliche Anzahl von Loren zu bestücken. Somit war auch das immer in Frage gestellte Abendessen gesichert. Und somit bekam ich von Tag zu Tag mehr Kraft und konnte nach einigen Wochen auf die Hilfe meines „Rauchpartners“ verzichten.
Doch damit war die Welt auch nicht in Ordnung. Denn ohne Charlies Hilfe war ich nun vor den Attacken der anderen „Starken“ nicht mehr sicher. Also musste ich mich selbst verteidigen. Dies widersprach zwar meiner Erziehung (Opas Ratschlag lautete: Probleme löst man mit Verstand), es musste aber in dem einen oder anderen Falle einfach sein. Als ich dann einmal meine Hemmungen vollkommen überwand und einen der „Platzhirsche“ die „Luft raus ließ“, hatte ich anschließend meistens meine Ruhe.
Ich wünsche, niemand möge jetzt denken: Ja, wenn man nach ein paar Wochen Plagerei schon im Steinbruch klar kam, konnte es nicht so hart gewesen sein. Oh doch! Der Steinbruch war die Hölle! Es war nicht das frühe Wecken und das kaum ausreichende Frühstück, da sich die Stärkeren, wie bei allen anderen Mahlzeiten auch als erste „bedienten“, ja mitunter bedienen ließen. Der immer mit im Speisesaal anwesende Erzieher bemängelte dies jedoch äußerst selten.
Ganz schlimm war die Heimkleidung, die mir persönlich arg zu schaffen machte. Geflickte Kleidung war der Zeit angemessen. Wir waren vier Kinder zu Hause und Oma kam kaum mit Sockenstopfen und Hosenflicken und dergleichen nach. Aber was Oma flickte, kratzte hernach nicht. Die Heimkleidung kratzte überall. Nicht nur, weil sie mir immer zu groß war. Beim Wäschewechsel, ich glaube wöchentlich einmal, wurde meine Beschwerde in dieser Sache ignoriert. Schlimmer als das Jucken war aber, dass mich weder Hose noch Jacke wärmte.
Die harte Arbeit im Steinbruch
Ich fror schon beim Marsch nach „Abbessinien“, so nannten wir den Abschnitt im Steinbruch, in dem ich mich einzufinden hatte. Andere Zöglinge arbeiteten in „Korea“ oder der „Mandschurei“, wie wir die Steinbruchabschnitte unter uns Zöglingen nannten. Ich fror, obwohl ich schon auf dem Weg zum Arbeitsplatz ganz schön in Bewegung war. Es mochte etwas mehr als ein Kilometer gewesen sein, der zurückgelegt werden musste. Doch den lief ich und gar manch anderer „Schwächling“ anfangs fast immer doppelt. Die stärkeren machten sich einen Spaß daraus, uns die verschlissenen Mützen vom Kopf zu schlagen und hinter sich zu werfen.
[ SEITE 5: ]
sich zu werfen. Wir „Sklaven“ durften diese dann immer wieder holen. Beim Heimgehen, ging es dann wesentlich schneller. Da sollten wir noch bevor der markante Dauerton einer Sirene die Sprengungen im Steinbruch anmahnte, im Heim angelangt sein, denn es konnten uns ansonsten Gesteinsbrocken treffen. Einen Schutzhelm, geschweige denn Schuhe mit Stahlkappen, die dort zwingend nötig gewesen wären, waren anscheinend noch nicht erfunden. Man schrieb ja erst das Jahr 1965.
Die Arbeit im Bruch war ebenso schwer wie eintönig. Man hatte große, massive Eisenloren mit den vorher aus den Steinbruchwänden gesprengten Basaltbrocken (ich hielt sie damals für Granitsteine) zu füllen. Die Steine wurden zu Uferbefestigungen gebraucht und durften daher nicht zu leicht sein. Für mich waren alle Brocken schwer, die meisten zu schwer. Ganz große Steine wurden von Baggerfahrer Dieter mit der mächtigen Baggerschaufel bearbeitet bis sie brachen. Gar mancher, dabei wegsplitternde „Blindgänger“, traf mitunter uns Zöglinge.
Nun, damit konnten wir leben. Nicht leben konnte ich mit der Gefahr, welche von dem Gestein ausging, das nach einer Sprengung vom Frost noch in der Wand gehalten wurde. Von diesen Brocken ging die größte Gefahr aus. Nicht selten lösten sich diese, wenn die Wintersonne, meist gegen Mittag, etwas intensiver ihre wärmenden Strahlen auf die an die zwanzig Meter hohen Bruchwände warf. Da half nur selten ein Sprung zur Seite und es war einfach Glück nötig. Es ist wie ein Wunder, dass keiner in der Zeit, in welcher ich im Steinbruch arbeiten musste, vom Gestein erschlagen wurde. Verletzte gab es hingegen immer wieder. Ich spreche nicht von kleineren Blessuren wie Quetschungen, Hautabschürfungen und anderen Nichtigkeiten. Ich spreche auch nicht von den Schmerzen, die ich mir immer wieder einhandelte, als ich die schweren vollen Loren, unter Einsatz aller meiner Kräfte anschob, damit diese vor zum „Transport-Berg“ rollten, wo sie dann nach unten glitten und mit ihrer Energie zeitgleich leere Loren auf einem Gegengleis hochzogen. Meine Aufgabe war dann, diese Loren abzukoppeln und vor zur Wartestelle zu schieben. Mein Problem waren meine Handschuhe. Ich nannte sie „Lumpen“. Nichts anderes waren diese nämlich. Es waren aneinander genähte Wollteile, total verschlissen, dünn und löchrig wie ein Schweizer Käse. Und durch diese Löcher hindurch berührte meine Haut zwangsläufig die eiskalten eisernen Loren. Und nicht selten klebten meine Hände anschließend an ihnen. Um nicht den Transportberg hinabgerissen zu werden, musste ich meine Hände dann immer von dem kalten Metall losreißen. An manchen Tagen hinterließ dies Wunden bis aufs Fleisch.
Doch Fleischwunden verheilen irgendwann. Nicht verheilt und nie verheilen wird die Wunde, die mir nach Ostern 1965 ins Herz gerissen wurde. Es war die Nachricht meiner Schwester, die sich in einem Brief verwundert darüber äußerte, dass ich nicht zu Omas Beerdigung gekommen sei. Meine Oma war in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag 1965 verstorben. Dieser Brief meiner Schwester, den mir Herr Plietsch, einige Wochen nach Ostern in seinem
[ SEITE 6: ]
Büro vorlas, ließ meine Welt einstürzen. Ich finde auch heute noch keine Worte, um meine damalige Verfassung zu beschreiben. Ich war nur fertig mit der Welt. Mit der verlogenen Welt der Erwachsenen. Mit den Schönrednern, die es ja nur gut mit uns Jugendlichen meinten und die sich in Wirklichkeit einen Dreck um unser Schicksal scherten. Wie war es möglich, dass eine kirchliche Einrichtung, die Innere Mission – Träger des Erziehungsheims Voccawind, im 20. Jahrhundert erlaubte, ja erzwang, dass Jugendliche Zwangsarbeit im Steinbruch zu leisten hatten? Dass Kinder nicht zur Beerdigung ihrer Großeltern durften, da die eigene Mutter dies durch Nichtinformation verhinderte? Oder hatte es das Stadtjugendamt verboten, dass ich am Grab meiner Oma trauern und von ihr Abschied nehmen durfte? War ich ein Schwerverbrecher?
Keine Schwierigkeit bereitete es, bei Nacht aus dem Heim zu schleichen und sich aufzumachen zu Omas Grab auf dem Westfriedhof in München. Schwer war allerdings der Weg. Die Fetzen, die wir als Heimkleidung erhielten, waren nicht für Märsche dieser Art geeignet. Nicht nur, dass man in solcher Bekleidung gleich überall aufgefallen wäre, nein, sie ließ auch die Kälte der Nächte bis auf die Knochen durchkommen. Und nur nachts konnte man es riskieren zu laufen, tagsüber wäre man bestimmt nicht lange unentdeckt geblieben. Entdeckt wurde ich dann bei Nürnberg und sofort ins Heim zurückgebracht. Die Hiebe beim Spießrutenlaufen schmerzten weniger als die Gewissheit, jetzt lange keine Chance mehr zu haben, Omas Grab zu besuchen.
Mein Entweichen hatte weiter keine schwerwiegenden Folgen. Ich durfte nach wie vor an Samstagen die Autos von den Herren Plietsch jun. und sen. waschen und polieren und erhielt dafür auch immer eine Kleinigkeit. Als dann später Plietsch jun. heiratete, überließ mir das Brautpaar Tage nach der Hochzeit einen großen Teil ihrer Hochzeitstorte mit den Worten: Ich dürfe sie alleine genießen oder ich könne mit den anderen teilen. Ich habe den weitaus größeren Teil des kostbaren Geschenkes dann selbst genossen.
Nie hätte ich es für möglich gehalten, dem Heimleben auch etwas Positives abzuringen, aber mit der Zeit musste ich erkennen, dass ich nicht mehr Tag und Nacht ans Abhauen dachte. Es fiel zwar wahnsinnig schwer, sich vorzustellen, dass man hier ausharren sollte, bis man volljährig würde (damals [in der Bundesrepublik Deutschland] mit 21 Jahren), doch vielen der Insassen ging es ja genauso. Sie kamen auch aus kaputten Familien, doch wir verstanden es, uns untereinander Mut zuzusprechen. Da vergaß man schon mal meine Sehnsucht nach Oma, die ja leider schon verstorben war.
Die Wende zum Guten
Oma und Opa waren für mich meine wirklichen Eltern. Sie haben meine drei Schwestern und mich anständig, auch unter den widrigsten Umständen, erzogen. Nicht meine Mutter, die, kaum dass ich zwei Jahre alt war, schon wieder geschieden war, die mehr oder weniger nur spätabends von der Arbeit kam und die wir Kinder, wenn überhaupt, nur an den Wochenenden zu sehen bekamen. Aber auch an den Wochenenden sorgten meine Großeltern sich
[ SEITE 7: ]
rührend um uns Kinder, da Mutter ja zum Eisessen in den Königshof am Stachus musste oder mit irgendeinem Verehrer ein Picknick in den Isarauen genoss.
Meine letzten Monate in Voccawind wurden spannender. Ich kam wieder mit „normalen“ Menschen in Kontakt. Die Zöglinge, die sich gut geführt hatten, durften nämlich plötzlich auswärts arbeiten. Mein erster Einsatz war bei der Fa. Kugelfischer, nahe Ebern. Dort wurde ich aber, ich weiß nicht warum, nur ca. eine Woche beschäftigt. Ich wurde dann bei der Fa. Gaudlitz in Coburg gebraucht. Anfangs fiel es mir schwer, mit den Frauen und Mädchen am Arbeitsplatz mitzuhalten. Viel zu ungeschickt waren meine, mittlerweile an schwerste Arbeiten gewohnten Hände, für die jetzt abverlangte, feinfühlige Schleiferei von Plastikgebilden, die vor Ort in den Pressen gefertigt wurden und deren „Grate“ ich nun abzuschleifen hatte.
Bald schon waren meine Finger mit Wasserblasen jeglicher Größen versehen. Meine im Steinbruch erworbene Hornhaut bot nur kurzfristig dem Schleifpapier die Stirn. Und als ich dann nach ca. zwei Wochen den Bogen raus hatte und eben so schnell wie die hübsche Blonde, am Arbeitstisch neben mir, die Plastikteile zu entgraten vermochte, genierte ich mich auch nicht mehr wegen meiner derzeitigen Herkunft. Ja, ich habe mich anfangs sogar geärgert, als ein junger Schlosser „meine“ Vorarbeiterin bat, sie möge doch einen Arbeiter zu seiner Unterstützung kurzfristig abgeben und deren Wahl dann auf mich fiel.
Ich arbeitete an diesem Tag mit den Bauschlossern und fand dann auch schnell Gefallen an dieser Tätigkeit und so wurde dies noch am selben Tag, nach Absprache mit mir, nun meine feste Stelle bei der Fa. Gaudlitz. Am meisten gefiel mir das Arbeitsklima in der Bauschlosserei. Es war ein toller Haufen. Und innerhalb kürzester Zeit war ich bei den Schlossern beliebt. Sie lobten meinen Einsatzwillen und waren überrascht von meiner Auffassungsgabe. Sie hätten einem „Kaufmannslehrling“ niemals ein solches Geschick in ihrer Branche zugetraut. Die Schlosser ließen mich nicht einmal spüren, ich sei ein Zögling, nein, sie behandelten mich eher wie einen Lehrbuben. Sie zeigten mir alles geduldig und lehrten mich vieles. Ich durfte Schweißen, Löten, Bohren und alles andere, außer Argon-Schweißen. Die Zeit in der Bauschlosserei der Fa. Gaudlitz in Coburg war die „schönste“ Zeit in meiner Voccawind-Ära. Unter den Schlossern fühlte ich mich sofort sehr gut aufgehoben. Sie waren unvoreingenommen mir gegenüber und verstanden es, mir Mut für meine Zukunft zu geben. Ohne diese hervorragenden Menschen wäre mein späteres Leben vielleicht anders verlaufen. Sie stellten mich nicht in Frage. Sie halfen mit Worten und Taten. Gar manche Brotzeit teilten sie mit mir.
Heute bin ich verheiratet, habe eine Tochter und zwei Söhne. Alle meine Kinder haben studiert und eine, so denke ich, schöne Kindheit und Jugendzeit erlebt und stehen vor einer passablen Zukunft. Und irgendwie haben die Schlosser der Fa. Gaudlitz im Jahre 1965 positiv dazu beigetragen. Und, obgleich sie Schlosser waren, verstanden diese Männer mehr von Pädagogik als so mancher Verantwortliche im Erziehungsheim in Voccawind, der Gleiches mit Gleichem
[ SEITE 8: ]
vergalt, also Schläge mit Schlägen. Nun, eine kirchliche Einrichtung entschied halt noch im 20. Jahrhundert nach „Aktenlage“: Auge um Auge, Zahn um Zahn!
Denn als ich schließlich im Dezember 1965 wegen guter Führung aus der „freiwilligen Erziehungshilfe“, wie der offizielle Status damals lautete, vorzeitig entlassen wurde, wurde ich nur mit einem dunkelblauen Anzug, einem weißen Hemd und einer silberfarbigen Krawatte, sowie in leichten Halbschuhen nach Hause geschickt. Einen Mantel, der in der Kleiderbestandsliste des Heimes eingetragen war und der das zur Jahreszeit passende Kleidungsstück gewesen wäre, konnte man mir ja schließlich nicht aushändigen, da es diesen ja auch nie gab. Ich betrat nämlich Voccawind im Januar 1965 ohne Mantel. Es gab ihn genau so wenig, wie mein in dieser Liste eingetragenes Geburtsjahr, denn ich war ein Jahr später geboren [ Jg. 1948 ]. Aber sorgfältigste Dokumentation sollte gerade Pädagogen nicht fremd sein, entscheiden doch viele von diesen „Halb-Göttern“ nach Aktenlage.
Noch heute frage ich mich, wie diese Entscheidungsträger mit mir umgegangen wären, wenn ich 1965 eine Riesendummheit gemacht hätte. Eine Verfehlung, vor der mich das Schicksal aber Gott sei Dank verschonte. In der Mansarde eines großen Backsteingebäudes in der Schweren Reiterstrasse in München war damals ein Jugendgefängnis, in das ich am Morgen des 27. Januar von zwei Herren des Stadtjugendamtes verbracht wurde. Ich sollte dort bis Mittag bleiben, dann würden sie mich ins Jugendamt bringen, wo mein „Fall“ dann bearbeitet würde, hieß es. Nur, die Männer kamen nicht mehr. Mittags brachte dann ein junger Bursche das Mittagessen für uns neun Gefangene. Am Nachmittag beschlossen dann einige der eingesperrten Jugendlichen, den jungen Mann, wenn er das Abendessen brächte, zu überwältigen und abzuhauen. Auch mich fragten sie, ob ich mitmachen würde. Und ich habe zugestimmt, denn ich wollte aus dem Gefängnis hinaus, in dem man mich festhielt, obwohl ich nichts gemacht hatte. Ich hatte lediglich meine Schwester verteidigt, als sie von einem der vielen „Freunde“, sprich Freier, meiner geschiedenen Mutter brutal verprügelt wurde, weil sie ein von ihm angeordnetes Treppenputzen erst Stunden später ausführen wollte. Meine Schwester wollte erst ihren späteren Mann in der Kaserne in Landsberg am Lech besuchen, da später kein Zug mehr gefahren wäre.
Doch das Schicksal konnte damals auch gnädig sein. Am Abend des 27. Januar 1965 brachte nicht der Junge, sondern der Vater des jungen Burschen das Abendessen für die Inhaftierten im Jugendgefängnis. Und den traute sich, Gott sei Dank, keiner zu überwältigen. Wer weiß wie sonst mein Leben verlaufen wäre.
Meine Zeit in Voccawind war schlimm. Doch was ist das im Vergleich zu den Zöglingen, die ihr Leben in oder durch Voccawind verloren, denen die Minen an der nur ein paar Kilometer hinter dem Steinbruch liegenden damaligen Zonengrenze ihr junges Leben raubte oder deren Glieder verstümmelte oder zerfetzte. Der Verlauf der Grenze war damals bekannt. Der Freiheitsdrang der Jugend auch. Auch Euch? Wer fühlt sich hierfür verantwortlich? Wer,
[ SEITE 9: ]
ihr Jugendamtsmitarbeiter, ihr Verantwortlichen in der Inneren Mission und ihr Erzieher, so frage ich mich noch heute? Beschämend und erniedrigend war das Verhalten vieler Einwohner, die ihre Kinder von den Straßen holten und dann die Häuser versperrten, ja selbst die Fensterläden schlossen, wenn wir z.B. am Sonntag zum Kirchgang kamen.
Abschließend darf ich noch den Interneteintrag eines ehemaligen Heimzöglings zitieren. Er schrieb: „Hallo aus USA. Ich habe von 1960 bis 1963 im Erziehungsheim Voccawind verbracht. Das waren die drei schlimmsten Jahre meines Lebens. Schlimmer als mein Jahr in Vietnam beim amerikanischen [Militär]; [obwohl] ich den [Vietnam-]Krieg schwerverletzt überwunden habe.“
.